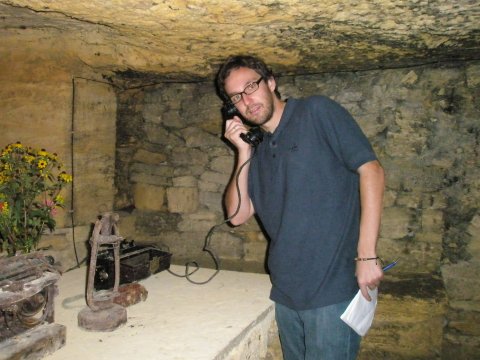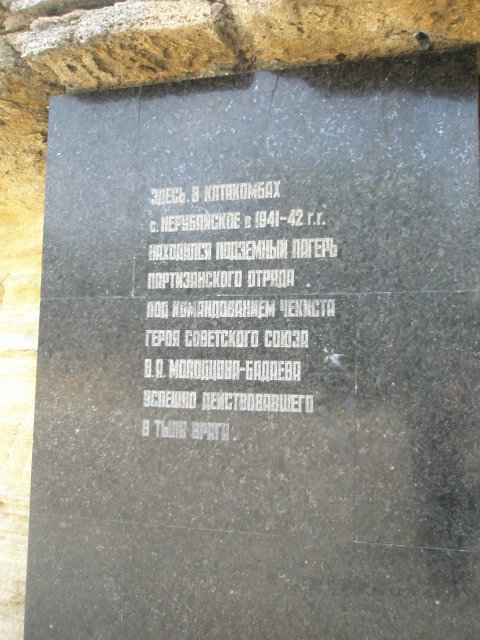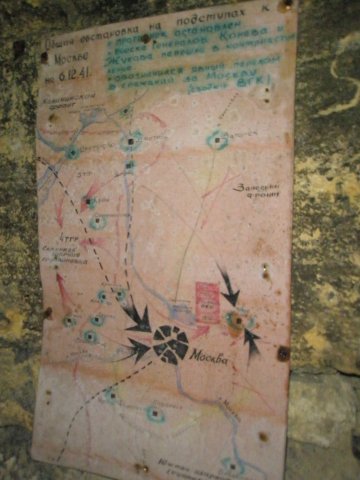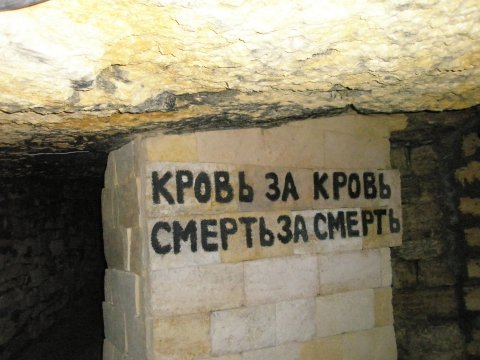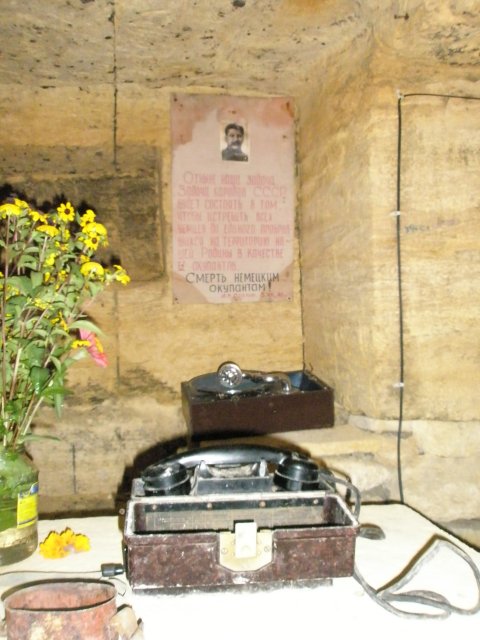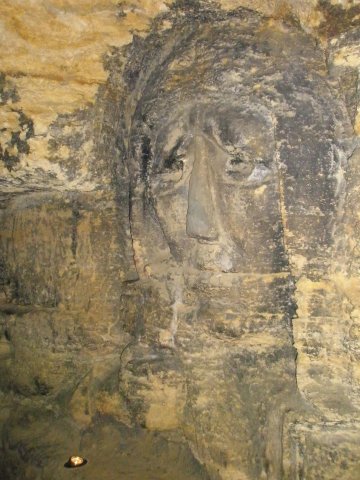ODESSA, UKRAINE Mein Freund Oleg ist ein Muttersöhnchen. Ich habe gar nichts dagegen, dass Männer ein vernünftiges Verhältnis zu der Frau haben, die sie auf die Welt gebracht hat. Aber vier Telefonanrufe pro Tag halte ich für einigermaßen unvernünftig. Riefe ich meine Mutter auch nur zweimal pro Woche an, würde sie einen der schlimmeren Psychologen Odessas auf mich ansetzen. Und meine Mutter lebt 2000 Kilometer entfernt, in einem anderen Land, sogar in einer anderen Zeitzone.

Den ersten Anruf machte Oleg am Freitagnachmittag, während ich den Motor startete, um uns zur Basa Otdycha in der Nähe der Hafenstadt Juschnij zu bringen. „Mama, wir fahren jetzt los, bisschen ausspannen, ich meld mich später…klar weiß der Kolumnist, wohin wir müssen”, sagte Oleg, verabschiedete sich und fragte dann mich: „Kennst du den Weg?”
„Gute Frage”, sagte ich.
„Schlechte Antwort”, sagte Oleg.
„Wird schon.”
„Glaub auch.”

Natürlich sind wir umhergeirrt. Oleg will im Auto keine Straßenkarten lesen, weil ihm davon schlecht würde, und ich kann so etwas ohnehin nicht, nicht mal in meiner Wohnung. Mein Orientierungssinn würde es gerade noch schaffen, mich auf einem Bauernhof zum Kuhstall zu navigieren. Dummerweise lebe ich mit dieser Schwäche im denkbar ungünstigsten Land Europas. Wenn ich von Odessas Zentrum zum Flughafen fahre, bin ich 20 Minuten unterwegs. Auf der gesamten Strecke ist der Flughafen einmal ausgeschildert – ziemlich am Anfang, und zwar dort, wo es geradeaus geht. Dass man nachher noch fünfmal abbiegen muss, um ans Ziel zu gelangen, wird als Wissen vorausgesetzt. Da Oleg und ich auch nicht die Typen sind, die rechts halten, die Scheibe herunterlassen und einen Ortskundigen befragen, wurden aus geplanten und geschätzten fünfzig Kilometern am Ende neunzig. In den kurzen Pausen war ich zu erschöpft gewesen, um ihn zu erwürgen, und Oleg hatte keine Hand freigehabt, weil er mit seiner Mutter telefonierte.

Die Basa Otdycha war eine Bungalowsiedlung dicht am Strand. Eine der Köchinnen stellte uns noch ein Abendessen hin und sagte schließlich, ehe sie den Speisesaal verließ, in dem um kurz nach neun nur noch Oleg und ich saßen: „Erholt euch gut.”
„Hoffentlich haben die hier keine Plumpsklos”, flüsterte Oleg.
„Fürs Blog wär’s gut.”
Unser Quartier hatte ich über den Schwager meiner Vermieterin gebucht, der in einer Firma arbeitet, dessen Geschäftsführer mit einer Frau befreundet ist, in deren Restaurant hin und wieder einer speist, der über den Taufpaten seines zweiten oder dritten Kindes den Direktor der Basa Otdycha kennt – für ukrainische Verhältnisse hatte ich also recht direkt und unumständlich gebucht. Den Abend ließen wir mit ein paar Bieren vor unserem Bungalow ausklingen. Wir spielten Karten, irgendein Autoquartettspiel, das Oleg an der Tankstelle gekauft hatte, und erzählten uns Ferienlagerwitze. In der Nacht träumte Oleg von Ostfriesen und ich von Moldawiern und seiner Mutter.

Am nächsten Morgen sahen wir im Speisesaal nicht nur, dass es keine Teller gab, weshalb die Mütter die Brotscheiben direkt auf den Tisch legten, um sie mit Butter oder Quark zu bestreichen. Wir bemerkten auch, dass sich die anderen Urlauber – ich hatte noch nie größere Familien gesehen als diese mit fünf bis acht Kindern – vor dem Frühstück an den Händen hielten und ein Gebet sprachen.
„Wohin hast du mich bloß verschleppt?”, fragte Oleg.
„Es ist ein Erholungsheim der Kirche, was hast du erwartet?”
Oleg trank einen Schluck Tee und sagte: „Wir wollen ja nicht unangenehm auffallen. Oder wollen wir das?”
„Nein.”
„Na dann, du oder ich?”
„Du!”
Oleg erhob sich von seinem Stuhl und griff meine Hand, zog mich hoch, räusperte sich, schloss die Augen und sprach sehr leise: „Lieber Gott, wenn es Sie wirklich geben sollte, machen Sie bitte, dass der Kolumnist heute Nacht nicht wieder so laut schnarcht. Und dürfte ich Sie vielleicht noch um einen zweiten Gefallen bitte? Bitte sorgen Sie auch dafür, dass die Leute nicht denken, der Kolumnist und ich seien ein Paar. Der zweite Wunsch ist mir übrigens noch ein bisschen wichtiger. Danke und Amen.” Oleg öffnete die Augen und stierte mich an. Er nickte mir streng zu, schnitt eine Grimasse und sagte schließlich, weil ich immer noch nicht kapiert hatte: „Nun mach schon, ich muss noch telefonieren!”
„Amen?”
„Geht doch.”
„Warum siezt du eigentlich Gott?”, frage ich.
„Er hat mir noch nicht das Du angeboten.”

Am Mittag stiegen wir auf den Berg, um von oben die Bungalowsiedlung und das spiegelglatte Meer anzuschauen. Alte Ladas, klein wie Matchbox-Autos, torkelten über die schlammige und holprige Straße. In der Ferne schaukelten Möwen. Wir entdeckten schon lange halbfertige Häuser, ein Scheißhaus, das sich diesen Titel redlich verdient hatte, und schließlich ein Feuer im Gestrüpp.
„Soll das brennen?”, fragte ich.
„Das brennt freiwillig”, sagte Oleg.
Er wischte mit seiner Hand einmal den Horizont entlang, atmete aufdringlich, legte sich ins vertrocknete Gras und schaute zum Himmel hinauf. Wir schwiegen fünf Minuten.
„Ist die Ukraine nicht eigentlich wunderschön?”, fragte er dann.
„A-ha.”
„Was?”
„Ich weiß nicht”, sagte ich.
„Was stört dich denn jetzt wieder?”
„Ich weiß nicht, ob ich auf Dauer in einem Land leben könnte, in dessen Plattenläden es drei CDs von Modern Talking gibt und sogar zwei von Thomas Anders, aber nicht die neue CD von a-ha. Plattes Land.”
„Das war jetzt ganz knapp unter deinem Niveau und sehr deutlich unter meinem”, sagte Oleg.
„Mein Niveau ist im Kurzurlaub.”

Am Abend, bevor wir zur Stranddiskothek aufbrachen, rief Oleg abermals seine Mutter an. „Ich bin jetzt ein paar Stunden nicht erreichbar”, sagte er und lauschte. „Nein, ich mache nicht so lange…ja, kannst dich auf mich verlassen…ich trinke höchstens vier…okay, drei…bis später, Mama…mach dir keine Sorgen. Der Kolumnist passt auf mich auf…nein, Mama, das ist kein Grund, sich erst recht Sorgen zu machen.”
Am Vormittag hatten wir eine halbe Stunde lang einen Spiegel gesucht. Es gab in der ganzen Bungalowsiedlung nicht einen, weder in der Gemeinschaftsdusche noch über irgendeinem der vielen Waschbecken im Gemeinschaftsklo. Oleg hatte mich sogar genötigt, die Damentoilette auszukundschaften, und derweil Schmiere gestanden. Da er nicht wollte, dass wir ausgingen, wie wir aussahen, stellte er sich vor mich hin und richtete auf meine Hinweise seine Haare. Er wichste sich Tuben-Gel in die Handfläche und fragte mich, wie er es verteilen müsse, holte einen Kamm aus der Gesäßtasche und ließ mich dirigieren.
„Ich denke, das sieht gut aus”, sagte er. „Und jetzt du, Spiegel-Kolumnist!”
„Oleg, wir gehen in eine ranzige Stranddiskothek. Es gibt dort nicht mal ein Klo, und das Meer zählt nicht.”
„Und das, was du da auf dem Kopf hast, zählt nicht als Frisur.”
„Seit ich denken kann, hatte ich noch nie eine Frisur. Ich habe nur Haare”, sagte ich und zupfte irgendwo herum, um Oleg einen Gefallen zu tun.
„Dein Scheitel ist auch nicht mehr das, was er heute Morgen noch war.”
„Besser?”, fragte ich.
„Nö.”
„Besser?”
„Nö.”

In der Diskothek versuchte Oleg, eines der Mädchen zu erobern, die er nachmittags am Strand begutachtet und für begehrenswert befunden hatte. Nach dem sechsten oder siebten Wodka war allerdings sein Orientierungssinn dahin, und Oleg hatte Mühe, das Mädchen aus Lugansk nicht mit dem Mädchen aus Lviv zu verwechseln. Ich ließ ihn irgendwann zurück und torkelte davon. Vor dem Schlafengehen inspizierte ich noch Olegs Telefon – zwei Anrufe in Abwesenheit.
Ich weiß, dass Oleg ein enges Verhältnis zu seiner Mutter hat, ich weiß auch, dass Ukrainern die Familie heilig ist, jeder kümmert sich um jeden, sicher auch, weil sich der Staat um nichts kümmert. In Deutschland war das auch mal so. Drei oder vier Generationen, von der Zweieinhalb- bis zur Zweiundneunzigjährigen, lebten unter einem Dach. Uropa spielte mit seinem Urenkel, sie verstanden sich prima – nicht nur, weil sie genauso viele Zähne hatten und ähnlich mobil waren. Von heute aus betrachtet, wirkt diese Welt ungemein romantisch; in Wahrheit war – und wäre – sie die Hölle.
Ich habe einmal einen Familientherapeuten gefragt, wie es die Leute – Tochter, Mutter und Großmutter, Sohn, Vater und Großvater – früher ertragen hätten, sich so nahe zu sein. „Sie hatten ja meist gar keine Wahl”, sagte der Mann und kratzte sich am Kopf. „Und jeder siebte ist halt mit einem sehr dicken Strick auf den Dachboden gestiegen und nicht mehr runtergekommen.”
Natürlich war die Luft in dieser Provinz sauberer als in Odessa, das Wasser klarer und geruchloser, die Stille ein bisschen durchdringender. Es hüpften sogar ein paar Vögel herum, die ich in der Stadt noch nie gesehen hatte und die wahrscheinlich jeden Ornithologen ziemlich geil machen würden. Aber ein stabiles Ökosystem bedeutet eben auch: Mücken, Ameisen und Käfer vorm und im Bungalow, im Klo und in der Dusche. Am Morgen, nachdem er in der Diskothek beinahe verendet wäre, reichte es Oleg. Er griff zum Telefon und drückte die Wahlwiederholung.
„Mama, hast du einen Tipp, was wir gegen diese fiesen Insekten tun können?”, fragte er, hörte ein paar Minuten aufmerksam zu, nickte hin und wieder, mehr zu sich allerdings als zu mir, schließlich bedankte er sich, massierte sein Kinn und überlegte.
„Sag schon, was hat sie empfohlen?”, fragte ich.
„Kopfnüsse.”
„Kopfnüsse?”
„Kopfnüsse.”
Alle Oleg-Kolumnen: